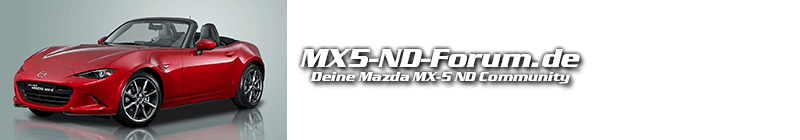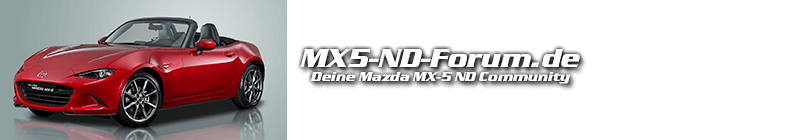Ich meide die Alpen mittlerweile weiträumig, egal ob mit 2 oder 4 Rädern.
Jain,
wir waren jetzt 10 Tage am Gardasee einschl. Pfingstwochenende bei Kaiserwetter. Abgesehen mal von den Hotspots (Brasa-Schlucht oder Kaiserjägerstraße) waren wir über weite Strecken mutterseelenallein unterwegs. Selbst die Kurvenorgien rund um den Monte Baldo waren Lichtjahre von dem entfernt, was man z. B. von den Dolos kennt.
Das Chaos war auf der Kaiserjägerstraße. Teilweise nur mit Rangieren oder wieder rückwärts zur letzten Ausbuchtung. Erschwerend kam dort hinzu, dass vor kurzem eine Etappe des Giro dort langführte. Radfahrer über Radfahrer, die ihren Vorbildern nacheiferten und bergab völlig enthemmt und lebensverneinend langhämmerten.