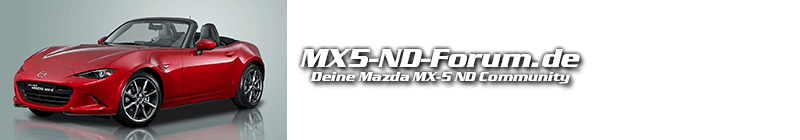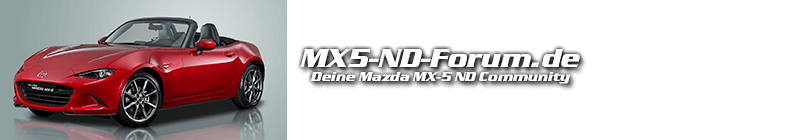Es zwingt dich ja niemand, zu einem Mehrmarkenhändler zu gehen. ![]() Und du willst doch wohl au h keinen Händler zurück in die Abhängigkeit zwingen.
Und du willst doch wohl au h keinen Händler zurück in die Abhängigkeit zwingen.
Beiträge von harkpabst
-
-
ka wie die so ein Video hochkant(!) filmen konnten, ...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Danke für fas Video, abet deine Definition von “hochkant“ müsstest du bei Gelegenheit noch mal erläutern. Ich hab's noch nie geschafft, ein Quadrat hochkant hinzustellen.

-
Ich tanke immer nur bis zum Klack, auch da hat es dann noch mind. 100km Restreichweite.
So ist es. Das Nachfüllen bis auf den letzten Milliliter habe ich mir schon lange abgewöhnt.
-
Andere Geräte nahmen die Route klaglos entgegen und schnitten beim Aufruf einfach hinten ab. Das war klasse...
So elegant machte es z.B. auch TomToms Urban Rider. Da waren es, wenn ich mich recht erinnere, sogar nur 48 Wegpunkte. Gut, wenn man das vorher einmal ausprobiert, bevor man sich darauf verlässt.

-
Was auch seit einiger Zeit verstärkt zu beobachten ist, dass sich viele Händler immer mehr Marken ´reinholen. Ob das nun der Gewinnsteigerung oder eher dem eigenen Überleben geschuldet ist, keine Ahnung, auf jeden Fall scheint die Fachlichkeit des Personals dabei immer mehr auf der Strecke zu bleiben.
Das ist aber ein zweischneidiges Schwert das du hier ins Feld führst. Man muss sich einmal daran erinnern: Früher konnten die Hersteller den Händlern vorschreiben, dass sie keine andere Marke bedienen durften (wenn die Ehefrau nicht mal zufällig eine eigene GmbH gegründet hatte)! Das war ganz sicher nicht im Interesse des Kunden. Glücklicherweise ist das dank EU nicht mehr der Fall.
Kompetenz hängt sicher von anderen Faktoren ab. Mein Händler verkauft allerdings Mazda, Mazda und dann auch noch Mazda und ich bin tatsächlich froh darüber.

Entgegen meiner ersten Vorstellungen habe ich das Spoilerpaket in Wagenfarbe lackieren lassen, dabei aber ein Teil der sichtbaren Flächen schwarz gelassen.......sieht man erst auf den zweiten Blick...aber raffiniert......muss mal Bilder machen....
Korrekt.
-
-
Das in 2016 bis jetzt mehr MX-5 in Europa verkauft wurden als in USA und Kanada zusammen überrascht mich aber...
Das setzt tatsächlich einfach nur den Trend fort. Kanada lasse ich mal außen vor, aber seit 1999 sind fast immer mehr MX-5 in Europa als in USA verkauft worden (Ausnahmen: 2000, 2001, 2013).
-
Ultaleggera oder Alleggerita in 16x7
mit Toyo R1R in 205/50
Das kann man so ruhig machen.

-
Bisher immer Glück gehabt, aber es war schon ein paar Mal ähnlich eng. Claudia bekommt immer die Krise, wenn ich wieder einen neuen Rekord aufstellen will, ich find's lustig

Kommt mir sehr bekannt vor.

Hab gerade einmal nachgeguckt: Mehr als 39,7 Liter habe ich doch tatsächlich noch nie getankt. Und das war auf kleiner Verbrauchsrekordfahrt nach exakt 600 km.
-
Offen gesagt bin ich schon der Meinung, dass die neue Aufteilung der Optionspakete den Modelllinien Exclusive-Line und Sports-Line prinzipiell viel mehr entsprechen.
Weniger schön ist natürlich die offene und die versteckte Preiserhöhung bei diesen beiden Ausstattungslinien. Da hat es meiner Meinung nach die EL noch schlimmer getroffen als die SL. SL ist in unveränderter Vollausstattung "nur" 200 € teurer geworden, die EL unter Wegfall der Domstrebe 300 €. Dafür kann man jetzt für saftige 750 € den ganzen Sicherheitsklimbim der SL nachkaufen, die werkseitige Domstrebe bekommt man nicht zurück.
Ich glaube nicht, dass ein neuer Interessent die Optionen sinnloser finden wird, als es vorher der Fall war. Aber ich sehe die Verschlechterungen natürlich auch.